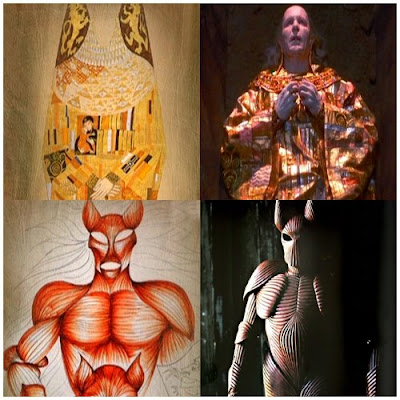Wiki deutsch Wiki englisch
Laura Mulvey hat den bahnbrechenden feministisch-filmtheoretischen Artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema geschrieben. Ich hole die Lektüre derzeit nach, aber der Inhalt des Artikels ist für dieses Blog auch gar nicht so sehr interessant – wie die meisten wissenschaftlichen Arbeiten stehen die Thesen jederzeit zur Diskussion. Sie selbst hat die Aussage später wohl in einem weiteren Artikel gemildert und umformuliert, als Erstschlag einer feministischen Betrachtungsweise in der von der männlichen Betrachtungsweise dominierten Welt des Films, der Wissenschaft und der Filmwissenschaft hat der Artikel jedoch seine ursprünglichste Existenzberechtigung.
Der Artikel ist die Quelle eines Begriffsrahmens, der mir nicht nur bei der Benennung, sondern zum Teil überhaupt erst beim Erkennen eines Gefühls hilft, das ich des öfteren beim Filmekucken habe: Nämlich die irritierende Wahrnehmung des männlichen Blicks. Gerade in meinem Lieblingsgenre, dem Horrorfilm, werden Frauen ja sowohl als Sexualobjekt wie Mordopfer – eine psychoanalytische Identität beider Rollen dahingestellt – bevorzugt und ihre Darstellung ist oft genug eine exploitative. D.h.: Die Mädels sind im Film so, wie Mann sie gerne sieht. Für mich als weibliche Zuschauerin ergibt das ein merkwürdiges Emotionsgemisch, da ich mich tatsächlich (dies ist valide Kritik an Mulveys Artikel) auch als Frau mit dem jeweiligen Protagonisten bzw. dem angesprochenen männlichen Zuschauer identifizieren kann – der „männliche“ Spaß am Film mithin auch meiner ist. Gleichzeitig jedoch identifiziere ich mich per default auch mit dem weiblichen Objekt/Opfer, was mich nicht nur in meiner Identifikation mit dem gesehenen Filmbild ins Dilemma stürzt, sondern sich auch in einer merkwürdigen Paranoia niederschlägt, die urplötzlich alle im Kinosaal (oder Wohnzimmer) befindlichen Männer zu (potentiellen) Spannern und/oder Aggressoren macht.
Eine ausgesprochen grafische Versinnbildlichung der Situation weiblicher Zuschauerinnen bei der Beanspruchung des männlichen Blicks findet sich übrigens in Katheryn Bigelows Strange Days, in der ein Vergewaltiger seinem Opfer den Livestream der Vergewaltigung aus seiner Sicht ins Hirn spielt. Ein mise-en-abyme aus Ausgeliefertsein, Schuldgefühl und sexueller Lust, bei dem sich mir persönlich der Magen umdreht.
Ein anderer Film, der mir in diesem Assoziationsraum einfällt und zu differenzierter Betrachtung einlädt, ist Neil Marshalls The Descent. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe, daher will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zu Überlegungen anregen, inwieweit dieser Film auch einen männlichen Blick einsetzt. Ist denn der Blick der Kamera per se männlich? Was würde das für diesen, in meiner Erinnerung ausgesprochen emanzipierten Film bedeuten? Mit seinen sechs weiblichen Hauptfiguren, die sich auch, aber nicht nur über ihre Beziehungen zu Männern unterhalten (womit der Film den Bechdel-Test mit Bravour besteht) und die als starke, aktive und kompetente Charaktere gezeichnet werden, habe ich ihn damals als eine ausgesprochene Wohltat im ansonsten sehr auf männliche Interessen und Vorlieben ausgelegten Horrorgenre erlebt. Nichtsdestotrotz lässt sich das Absteigen in eine dunkle Höhle, in der dann tödliche Gefahr lauert – nicht nur von der zu erwartenden Seite – als männliche Angst vor der Vagina dentata lesen. Ist dies also auch nur die intellektualisierte, verklausulierte Version eines „typisch männlichen“ Horrorszenarios? Oder – noch schlimmer – eine filmische Misogynie, die ihresgleichen sucht? Die ausschließlich weibliche Besetzung bedeutet ja für einen solchen Horrorfilm, dass alle Getöteten Frauen sind (zumindest auf der Protagonistenseite)!
Wenn also der Blick der Kamera per se männlicher Blick ist, dann ist dieser Film nicht emanzipiert, sondern auf höchster Ebene frauenverachtend. In meiner wohlwollenden Interpretation hingegen ist der Blick der Kamera zunächst neutral, doch durch das mise-en-scene und die gezeigten Objekte kann er explizit männlich werden. Im Falle von The Descent ist es eben die wenig klischeehafte und eben nicht objektifizierende Darstellung, die es nicht zulässt, diesen Film auf diese Art zu lesen.
Eine (anscheinend) lesenswerte Erörterung von Mulveys Essay kann man hier lesen.
Bild: Von Mariusz Kubik – Eigenes Werk, CC BY 3.0